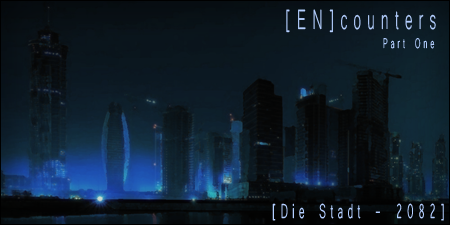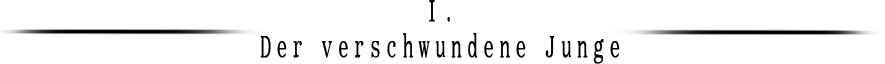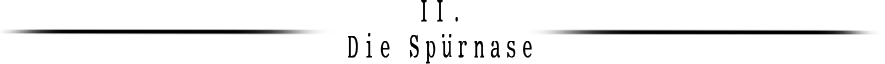Ich freue mich über jeden, der hierher gefunden hat und wünsche einen angenehmen und hoffentlich auch unterhaltsamen Aufenthalt!
Nachdem ich in meinem alten One-Shot Topic schon länger nichts mehr gepostet hatte und zudem in letzter Zeit relativ viele One-Shots schreibe, habe ich mich – in Absprache mit der Lieben @Kräme – entschlossen, ein neues Topic zu eröffnen, damit ich meine neueren Geschichten teilen kann.
Was gibt es hier zu sehen?
Nun, vorrangig schreibe ich One-Shots, die in Fandoms spielen, wobei ich hier vereinzelt auch kürzere Geschichten (sprich: Geschichten mit zwei bis vier Kapiteln, bei denen es sich kaum lohnen würde, ein neues Topic für sie zu eröffnen) posten werden, sowie ein paar tatsächliche Kurzgeschichten, also Geschichten des literarischen Genre „Kurzgeschichte“, die bei mir allerdings eher die Ausnahme sind. Ich habe an dem Genre eher wenig Spaß.
Viele der One-Shots derweil werden sich um Paare drehen, zumeist Girls Love Paare, also romantische Beziehungen zwischen zwei Mädchen. Wer an so etwas Spaß hat, wird hier sicher einiges nach seinem Geschmack finden. Wer an so etwas keinen Spaß hat: Nun, es gibt auch ein paar andere Geschichten, es macht halt nur den Großteil aus.
Darüber hinaus kann ich direkt sagen, dass das Fandom, das den größten Teil der Geschichten ausmachen wird, natürlich Digimon ist – allerdings über die verschiedenen Staffeln des Fandoms verteilt. Abgesehen von Digimon sind aber auch andere Fandoms wie beispielsweise Harry Potter, The Legend of Korra und natürlich auch Pokémon vertreten. :) Bei Digimon sind auch die meisten Paare angesiedelt, die nicht Girls Love sind, da ich hier durchaus auch Geschichten zu Hetero und Boys Love Paaren schreibe.
Im eigenen Bereich, also bei den Geschichten ohne Fandom-Einfluss, werden die meisten Geschichten von Ivory, einer jungen durch genetische Modifikation erschaffenen Söldnerin, und den „Eisbären“, einer geschlossenen Polytriade in Kanada, handeln. Die Geschichten zu Ivory sind One-Shots im Cyberpunk-Genre, die Geschichten der Eisbären Slice of Life.
Viel mehr gibt es auch nicht zu sagen!
Ich wünsche viel Spaß mit meinen Geschichten. :)


[Digimon Adventure/02]
My Sweet Valentine
Mimi/Miyako, Alltag, Fluff
Ungesagt
Taichi/Koushiro, Alltag, Drama, Romantik
[Digimon Tamers]
Kinder
Janyuu-centric, Janyuu/Mayumi, Alltag, Fluff
[Chihiros Reise ins Zauberland]
Zeit
Kein (angedeutet Chihiro/Haku), Drabble(s), Fluff
[Pokémon]
Sommer ohne Dich
Shirona/Hikari, Drama
[The Legend of Korra]
Unser Frieden
Korra/Asami, Fluff
[Shadowrun]
Unerwünschte Gespräche
Kein Pairing, Alltag
[Castlevania]
Trevor/Sypha/Alucard, Slice of Life
Nine Month [ENG]
Trevor/Sypha/Alucard, Slice of Life
A Strange Woman [ENG]
Dracula/Lisa, Romance
A Strange Man [ENG]
Dracula/Lisa, Romance
A Strange Outcome [ENG]
Dracula/Lisa, Romance
And Who Might You Be? [ENG]
Original Female Character/Original Female Character, Action/Adventure
Flirting Lessons [ENG]
OFC/OFC, Humor
Five Games Of Chess [ENG]
Hector/Isaac, 5+1, Queerplatonic Romance
A New Friend [ENG]
Kein Pairing, Family Fluff
Returning Nightmares [ENG]
Kein Pairing, Hurt/Comfort
A Game Of Nard [ENG]
Kein Pairing, Boardgame Story
Understanding [ENG]
Hector/Isaac, Hurt/Comfort
[Originale]
[Eisbären am Strand]
Eisbären & Kakao
♀/♀/♂, Alltag, Fluff
[[EN]counters]
[DIE STADT - 2082]
♀/♂, Cyberpunk, Drama
[DIE STADT - 2084]
♀/♀ , Cyberpunk, Drama, Erotik
[A Hare Among Wolves]
Der unsichtbare Freund
Kein Pairing, Krimi, Mystery
| Part I & II | Part III & IV |
[Manmade Myths]
Engelsschatten
Kein Pairing, Contemporary Fantasy, Action
Der See unter dem See
Kein Pairing, Atmosphärisch, Short
Heimat
Familie, Alltag, Short
Fragen
Kein Pairing, Mystery, Short
Fisch! | Tier. Lieb? | Weiße Tiger
Kein Pairing, Drabble, Humor
Monsterjagd
Kein Pairing, Action
[Sonstige]
Besenritt
♀/♀, Fantasy, Humor, Fluff
Rusalkasommer
Kein Pairing, Gruselgeschichte
Verschiedene Queere Paare, Gruselgeschichte
Vanille Macchiato & Honigkuchen
♂/♂/☿, Solarpunk Romanze
♂/♂/♀/♀/☿, Horror